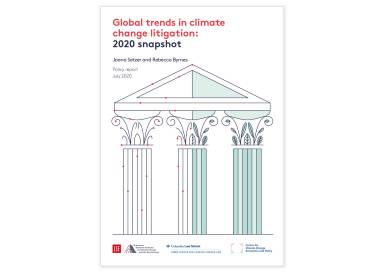Das Recht auf Zukunft
Ein Bericht von Christian Mihatsch
Immer mehr junge Menschen ziehen für ein lebenswertes Klima vor Gericht. Eine australische Studentin will so ihre Regierung zu mehr Klimaschutz zwingen.
An eine Zeit, in der sie sich wegen der Klimaerwärmung keine Sorgen machen musste, kann sich die 23-jährige Katta O’Donnell nicht erinnern. Sehr wohl ist der australischen Jurastudentin dagegen der Tag im Februar 2009 im Gedächtnis geblieben, an dem 173 Menschen bei den «BlackSaturday»-Buschfeuern ums Leben kamen: «Brennende Rinde fiel vom Himmel und der Rauch verdunkelte die Sonne.» Und auch dieses Jahr erlebte sie die verheerenden Brände hautnah mit. «Es war ein entscheidender Moment für mich, als ich begriff, dass die Feuer immer häufiger und größer werden.» Wie viele andere leidet O’Donnell auch emotional an diesem Wissen: «Ich habe Angst vor den Klimafolgen, die von vielen Leuten in meinem Alter geteilt wird», sagt sie. «Das Schlimmste ist das Fehlen von Gegenmaßnahmen.» Nun handelt die Studentin: Anfang August 2020 verklagte sie die australische Regierung. «Das Recht ist ein machtvolles Instrument», sagt sie und lächelt.
O’Donnells Klage ist in vielerlei Hinsicht typisch für Klimaklagen: Sie richtet sich – wie drei Viertel derartiger Klagen – gegen Regierungen. Sie wurde in Australien eingereicht, dem Land mit den meisten Klimaklagen außerhalb der USA. Und auch die Vorgehensweise der Jurastudentin ist typisch. Es handle sich hierbei um eine «strategische» Klage, schreibt Jacqueline Peel, Rechtsprofessorin an der «University of Melbourne», in einer noch unveröffentlichten Studie. Solche Verfahren «bieten einen Hauptkläger, erzählen eine fesselnde Geschichte und haben ein Ziel, das über die einzelne Klage hinausgeht». Außerdem würden sie oft von einer Medienkampagne begleitet. Auch sei O’Donnell noch jung – wie viele andere auch, die den Klageweg beschreiten.
Unkonventionelle Begründung für die Klage
Einzigartig hingegen ist O’Donnells Ansatz: Wie die meisten ihrer Landsleute zahlt sie bereits in jungen Jahren in eine Pensionskasse ein und besitzt über diese australische Staatsanleihen. Wie auch für andere Finanzprodukte gibt es für diese Anlagen einen «Prospekt», der Investoren über alle wesentlichen Risiken aufklären sollte. Doch der jungen Frau ist aufgefallen, dass dort gewisse Risiken komplett ignoriert wurden –nämlich diejenigen, die für den australischen Staatshaushalt aus der Klimaerwärmung entstehen. «Das ist eigenartig, denn Unternehmen an der Börse müssen beispielsweise alle Klimarisiken offenlegen.» Aus O’Donnells Sicht sind diese Risiken erheblich: «Im Jahr 2050, wenn meine Anleihen fällig werden, leben wir in einer extrem veränderten Welt, in der Klimaereignisse schwerwiegend und häufig sind.»
Australien und Kanada sind nicht für gute Klimaarbeit bekannt.
Australien erhält für seine finanzielle Solidität von den Ratingagenturen noch die Bestnote «AAA». Doch O’Donnell betont, dass die Klimakrise schon heute viel Geld koste: «Die diesjährigen Buschfeuer verursachten Schäden von umgerechnet rund 60 Milliarden Euro. Das Great-Barrier-Riff ist bereits zur Hälfte abgestorben und der Tourismus verliert Milliarden. Und auch die Bauern haben Schwierigkeiten.» Über die direkten Risiken durch die Klimaerwärmung und die Versauerung der Meere hinaus ist Australien zudem zwei indirekten Klimarisiken ausgesetzt: Das erste Risiko entspringt der Klimapolitik des Auslands. Kohle und Gas sind wichtige Exportprodukte für «Down Under». Fahren nun andere Länder die Kohleverstromung zurück, um ihre Emissionen zu senken, sinkt Australiens Exportvolumen und somit die Steuereinnahmen. Zusätzlich kommt der Wechselkurs des australischen Dollars unter Druck. Ein zweites indirektes Risiko auf die australische Klimapolitik erwächst aus den Reaktionen von umweltbewussten und weltweit tätigen Akteuren auf den Finanzmärkten.
So hat zum Beispiel die Schwedische Reichsbank im November 2019 Anleihen der beiden australischen Provinzen Westaustralien und Queensland sowie der kanadischen Teersandprovinz Alberta abgestoßen. Martin Flodén, Vizechef der Reichsbank, äußerte sich unmissverständlich: «Australien und Kanada sind nicht für gute Klimaarbeit bekannt. Als Resultat der neuen Investitionspolitik haben wir daher unsere Anleihen verkauft.» Für Keith Stewart von Greenpeace Kanada war das eine deutliche Warnung: «Zentralbanker sind keine Bäumeschmuser. Kanadische Politiker sollten daher aufmerken, wenn die Banker anfangen, Regierungsanleihen auf eine schwarze Liste zu setzen.»
Vielleicht wäre es der australischen Regierung möglich gewesen, all diese Risiken noch lange zu ignorieren, hätte nicht im Frühling dieses Jahres der Anwalt David Barnden einen Gastvortrag an der «La Trobe University» in Melbourne gehalten, an der Katta O’Donnell studiert. Nach der Vorlesung über finanzielle Risiken infolge der Klimakrise kamen die beiden ins Gespräch. Sie wollte von ihm wissen, was sie als junger Mensch unternehmen könne – und Barnden nahm den Faden auf. In den folgenden Monaten entwickelten sie zusammen mit weiteren Experten ihre Klage. Sie richtet sich gegen den australischen Staat und gegen die beiden Beamten, die für die Ausgabe von Anleihen verantwortlich sind.
«Katta O’Donnell v. Commonwealth of Australia»
Grundlage der Klage ist das australische Gesetz zur Finanzmarktaufsicht. Dort steht in Absatz 12 DA: «Eine Person darf im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen kein Verhalten an den Tag legen, das irreführend oder täuschend ist oder dazu geeignet, in die Irre zu führen oder zu täuschen.» Doch genau das tut aus Sicht der Jurastudentin die australische Regierung.
Während O’Donnell die Karte der «Offenlegungspflichten» ausspielt, um die Klimapolitik ihres Landes zu beeinflussen, wählen Klägerinnen und Kläger in vielen weiteren Fällen einen anderen Weg, um ihre Regierungen direkt zu mehr Klimaschutz zu zwingen. Den größten Erfolg erzielte ein Fall in den Niederlanden, der in seiner Argumentation auf die Einhaltung internationaler Vereinbarungen pocht. Im Jahr 2013 hatte die niederländische Stiftung «Urgenda» deshalb ihre Regierung verklagt: Diese verstoße mit ihrer Klimapolitik gegen die Europäische Menschenrechtskonvention, der die Niederlande angehören.
Der Klimawandel gefährdet die Menschenrechte.
Im November 2019 gab das höchste Gericht der Niederlande Urgenda schließlich recht: «Der Klimawandel gefährdet die Menschenrechte», schrieben die Richter in ihrem Urteil. «Um einen angemessenen Schutz dieser Rechte zu gewährleisten, sollte es möglich sein, sich auf diese Rechte gegenüber individuellen Staaten zu berufen.» Zudem zerpflückten sie die Argumentation der Regierung: «Der Staat sollte sich nicht hinter dem Argument verstecken, dass die Lösung des globalen Klimaproblems nicht allein von den niederländischen Anstrengungen abhängt.» Der Oberste Gerichtshof bestätigte damit die Urteile unterer Instanzen. Und so war die niederländische Regierung gezwungen, die Emissionen bis Ende 2020 um mindestens 25 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken – ursprünglich plante man nur eine Reduktion um 20 Prozent. Als Reaktion auf das Urteil legte die Regierung das 650-Megawatt-Kohlekraftwerk «Hemweg 8» des schwedischen Energiekonzerns Vattenfall still und begrenzte die Betriebszeiten für andere Kohlemeiler.
Hohe Hürden für die Zulassung vor Gericht
Die Bedeutung des Urgenda-Urteils geht weit über die Schließung eines Kohlemeilers hinaus. Es schafft einen Präzedenzfall für die Überwindung von zwei zentralen Hürden bei Klimaklagen gegen Staaten: Zum einen muss sich das Gericht trauen, die Klimaziele eines Landes juristisch zu bewerten, die Ziele müssen also «justiziabel» sein. Zum anderen muss das Gericht bereit sein, minimale Klimaziele zu definieren. Wie hoch diese beiden Hürden sind, zeigt sich an Fällen, bei denen die Gerichte nicht den Mut hatten, diese zu überwinden.
An der Justiziabilität scheiterte der Fall «Juliana v. United States». 2015 hatten Kelsey Juliana und 20 weitere Jugendliche und junge Erwachsene von der US-Regierung verlangt, einen Plan zu entwickeln, um die CO2-Emissionen auf null zu reduzieren. Dies war bislang in mehreren Instanzen abgelehnt worden. Ein Berufungsgericht betonte zwar Anfang 2020: Der Klimawandel nähere sich dem Punkt ohne Rückkehr, das Versagen, die bestehende Politik zu ändern, könne eine Umweltapokalypse beschleunigen. Nichtsdestotrotz läge es aber nicht in der Kompetenz von Gerichten, über die Klimapolitik zu urteilen, denn diese sei nicht justiziabel, so die Richter in ihrer Entscheidung. «Dass die anderen Regierungsgewalten (das Parlament und die Regierung) sich ihrer Verantwortung entziehen, das Problem zu lösen, verleiht den Gerichten nicht die Möglichkeit, ihre Rolle zu übernehmen.» Kelsey Juliana geht nun mit Unterstützung der Anwälte von der Umweltorganisation «Our Children’s Trust» erneut in Berufung.
Deutsche Klimaziele – nur eine «Absichtserklärung»?
Wie schwer sich Gerichte damit tun, ein Minimum für die Klimaziele zu definieren, zeigt ein anderer Fall. Greenpeace und drei Familien hatten 2019 die Bundesregierung verklagt, weil absehbar war, dass Deutschland das Klimaziel für das Jahr 2020 nicht erreichen würde. Weil das Ziel nicht in einem Gesetz, sondern nur in einem Kabinettsbeschluss stand, wies das Verwaltungsgericht Berlin die Klage jedoch zurück. Der Beschluss stelle nur eine «politische Absichtserklärung» dar und sei daher nicht rechtsverbindlich. Zudem seien die deutschen Maßnahmen gegen die Klimakrise «nicht gänzlich ungeeignet oder völlig unzulänglich».
Hinzu kommt, dass der Weltklimarat IPCC nur ein globales CO2-Budget vorgibt: Wenn die Erwärmung mit zwei Drittel Wahrscheinlichkeit auf 1,75 Grad Celsius begrenzt werden soll, dann können weltweit noch 800 Milliarden Tonnen CO2 emittiert werden. Wie dieses Budget auf die verschiedenen Länder verteilt wird, sagt aber weder der IPCC, noch wurde dies im Rahmen der UN-Klimaverhandlungen geregelt. Daher ist es schwierig, genaue Klimaziele für einzelne Länder zu definieren. Das Verwaltungsgericht Berlin schrieb dazu: «Es spricht viel dafür, das weltweit verbleibende CO2-Restbudget zumindest gleichmäßig pro Kopf der Weltbevölkerung aufzuteilen.» Dazu verpflichten will das Gericht die Bundesregierung aber nicht: «Und es steht dem angerufenen Verwaltungsgericht unter Beachtung des Gestaltungs- und Einschätzungsspielraums der Exekutive nicht zu, diesen Maßstab der Bundesregierung als zwingendes und verpflichtendes Mindestmaß an Klimaschutz vorzuschreiben.»
Menschen müssen weiterhin eine menschenwürdige Zukunft haben.
Davon lassen sich Greenpeace und neuerdings auch Germanwatch nicht entmutigen und setzen nun auf das Bundesverfassungsgericht. Die beiden Umweltorganisationen unterstützen eine Verfassungsbeschwerde von Luisa Neubauer und acht weiteren jungen Menschen. Der zweite Versuch gilt dem «Klimaschutzprogramm 2030» der Bundesregierung, das 55 Prozent weniger Treibhausgase im Vergleich zum Jahr 1990 zum Ziel hat. Dieses sei unzureichend und verstoße gegen den Artikel 1 des Grundgesetzes, der besagt: «Die Würde des Menschen ist unantastbar.» Daraus folge, dass «Menschen weiter eine menschenwürdige Zukunft haben müssen». Mittlerweile wurde die Klage vom Bundesverfassungsgericht zur Stellungnahme an den Bundestag, den Bundesrat, das Kanzleramt, das Innen- und Justizministerium sowie an alle Landesregierungen verschickt, was Greenpeace als ersten Erfolg verbucht.
Das Recht junger Menschen auf ein sicheres Klima
Eine weitere Hürde bei Klimaklagen ist der Nachweis der Klagebefugnis. Um überhaupt klagen zu können, muss man in der Regel nachweisen, dass man besonders betroffen ist. Immer mehr Klimaklagen werden daher von Kindern und Jugendlichen geführt. So setzt man auch bei «Our Children’s Trust» in einigen Fällen auf Jugendliche und junge Erwachsene als Hauptkläger. Die Nicht-Regierungsorganisation aus den USA hat ausdrücklich zum Zweck, «das Recht auf ein sicheres Klima» für junge Menschen zu schützen.
In Rahmen einer kanadischen Klage («La Rose v. Her Majesty the Queen») nennt die NGO in der Klageschrift dafür drei Gründe: Jugendliche wie Cecilia La Rose besitzen noch kein Wahlrecht, und daher steht ihnen einzig der Gerichtsweg offen. Zudem repräsentieren sie «zukünftige Generationen», die nicht selber klagen können. Drittens gibt es auch einen juristischen Grund: Kanadas Klimapolitik führe zu einer Ungleichbehandlung von jungen und alten Menschen, was verfassungswidrig sei. Die Politik «nutzt den kurzfristigen wirtschaftlichen Interessen älterer Menschen und der Öl- und Gasindustrie zu Lasten der Kläger und aller Kinder und Jugendlichen. Das verstärkt den Eindruck, dass ihr Leben und Wohlbefinden nicht so wertvoll ist wie das von Menschen, die bereits erwachsen sind.»
Es gibt keine vernünftige Rechtfertigung dafür, die Lasten des Klimawandels auf zukünftige Generationen zu verlagern.
Ähnlich gelagert ist die Klage von Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus Portugal, die den Erfolg des Urgenda-Prozesses auf ganz Europa ausdehnen wollen. Anfang September 2020 verklagten sie gemeinsam mit den Anwälten des «Global Legal Action Network» 33 Mitgliedsländer der Europäischen Menschenrechtskonvention in Straßburg. Das betrifft alle 27 EU-Länder, Großbritannien, die Schweiz, Norwegen, Russland, die Türkei und die Ukraine. Die Kläger argumentieren, dass die politischen Klimabestrebungen dieser Länder nicht ausreichen, um die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen, und dass daher ihr «Recht auf Leben» gefährdet sei. Auch werten sie die aktuelle Klimapolitik als Diskriminierung aufgrund ihres jungen Alters.
Die Erfolgsaussichten dieser Klagen hängt von vielen Faktoren ab: von der geltenden Rechtslage, von der Rechtstradition (insbesondere hinsichtlich der Justiziabilität) und vom Verständnis von Klagebefugnis. Eine Auswertung des Londoner «Grantham Institute» zeigt, dass die Kläger relativ gute Chancen haben: Im Zeitraum von April 1994 bis Mai 2020 hatten 58 Prozent der Nicht-US-Klagen einen «günstigen» und nur 33 Prozent einen «ungünstigen» Ausgang.
Klimaklagen haben in den letzten drei Jahrzehnten zunehmend an Bedeutung gewonnen. Der Bericht «Global trends in climate change litigation: 2020 snapshot» gibt einen Überblick über die weltweit wichtigsten Entwicklungen im Zeitraum von Mai 2019 bis Mai 2020.
Hier können Sie den englischsprachigen Bericht von Joana Setzer and Rebecca Byrnes vom «Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment» herunterladen.
Klagen schaffen Öffentlichkeit
Im Hinblick auf Katta O’Donnells Klage sagt die Rechtsprofessorin Jacqueline Peel: «Ich glaube nicht, dass die Klage einfach abgewiesen wird.» Das bedeutet, dass sich wahrscheinlich ein Gericht inhaltlich damit befassen wird. «Eine Schlüsselfrage wird sein, ob das Gericht sich der Argumentation anschließt, dass Präzedenzfälle nach Firmenrecht analog auch auf Staatsanleihen angewendet werden können.» Sollte dies der Fall sein und das Gericht O’Donnells Klage stattgeben, hätte das Konsequenzen, so die Rechtsdozentin Anita Foerster von der «Monash University» in Melbourne: Die Regierung müsste dann über die finanziellen Risiken des Klimawandels informieren, das würde indirekt den Druck auf die Regierung erhöhen, diese Risiken anzuerkennen und entsprechend zu handeln. Aber selbst ein Misserfolg vor Gericht kann trotzdem ein Erfolg für die Kläger sein. Denn diese Klagen haben «das ausdrückliche Ziel, die öffentliche und politische Aufmerksamkeit für Klimafragen zu erhöhen», wie Jaqueline Peel in ihrer Studie schreibt. Ein Beispiel sei der Fall «Juliana v. United States», der ein enormes Medienecho ausgelöst hat.
Es ist eine moralische Verpflichtung, für diesen Planeten zu kämpfen.
Die junge US-Aktivistin Alexandria Villaseñor schreibt in einem an die Erwachsenen gerichteten offenen Brief: «Ich bin 15 Jahre alt und verbringe einen Großteil meiner Zeit mit Konferenzschalten, E-Mails, Redeauftritten und Protesten. Das sind wahrscheinlich andere Erfahrungen als die, die Sie in meinem Alter gemacht haben.» Villaseñor ist die Gründerin der Klimabewegung «Earth Uprising» und hat zusammen mit Greta Thunberg und 13 weiteren Kindern und Jugendlichen beim UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes eine Petition eingereicht: Argentinien, Brasilien, Deutschland, Frankreich und die Türkei verstießen mit ihrer Klimapolitik gegen die UN-Kinderrechtskonvention. Dieser Einsatz fürs Gemeinwohl hat seinen Preis, wie Villaseñors Brief zeigt: «Ich werde oft gefragt: ‹Vermisst du es, einfach ein normaler Teenager zu sein?› Und die Antwort ist ‹Ja›. Aber die Klimakrise bedroht jeden Aspekt meiner Zukunft. Es ist eine moralische Verpflichtung, für diesen Planeten zu kämpfen.»

Ähnlich sieht das O’Donnell. Jeder Einzelne müsse «seinen Teil dazu beitragen». Sie investiert dafür nicht nur bereitwillig viel Zeit, sondern nimmt auch Unannehmlichkeiten in Kauf. «Es ist schwierig, als Frau in der Öffentlichkeit zu stehen. Man bekommt auch viele negative Dinge ab. Das ließe sich ignorieren, aber ich glaube nicht, dass solches Verhalten ignoriert werden sollte. Es ist auch ein Teil des Problems.» Andererseits habe sie aber auch viele positive Erfahrungen gemacht: Die eigene Regierung zu verklagen, sei «nicht nur auf der persönlichen Ebene aufregend, sondern auch, weil man sieht, wie sehr der Rest der Welt eine solche Klage will. Die Welt braucht das im Moment.»
Aus Sicht der jungen Klägerinnen kommt noch ein weiterer Faktor hinzu: Sie fühlen sich machtlos und von den Erwachsenen im Stich gelassen. «Die Regierung scheint diese schwerwiegende Gefahr nicht ernst zu nehmen», sagt O’Donnell. «Das ist das, was mir am meisten Sorgen bereitet.» Dabei erkennt sie auch gewisse Parallelen zu den Anfeindungen, denen sie sich ausgesetzt sieht. «Wie bei Corona müssen wir akzeptieren, dass wir die Dinge anders machen müssen. Auch wie wir uns gegenseitig behandeln. Wir müssen die Erde und alles auf ihr respektieren.» O’Donnell ist letztendlich nicht überrascht, dass es insbesondere junge Frauen sind, die an vorderster Front beim Kampf gegen die Klimakrise stehen. Gefragt, ob dies ein wiederkehrendes Muster sei, antwortet sie: «Ja, das ist durchaus so. Und vielleicht ist Führung durch junge Frauen das, was die Welt im Moment braucht. Das andere hatten wir lange genug.»
2023: Katta O’Donnell und die australische Regierung einigen sich Update
Katta O’Donnell hatte mit ihrer Sammelklage Erfolg – die australische Regierung hat gut drei Jahre nach Erhebung der Klage eingelenkt und sich mit der Studentin auf einen Vergleich geeinigt, wie der Guardian am 30. August 2023 berichtete. Demnach stimmte das Kabinett um Premierminister Anthony Albanese zu, eine Erklärung auf der Website des Finanzministeriums zu veröffentlichen, in der anerkannt wird, dass es sich beim Klimawandel um ein systemisches Risiko handelt, welches sich negativ auf den Wert australischer Staatanleihen auswirken kann. Im Gegenzug zog O’Donnell einen Antrag auf Erklärung zurück, in dem sie der Regierung irreführendes Verhalten vorgeworfen hatte. Mit dem Urteil zeigte sich die Jurastudentin zufrieden: «Dies ist das erste Mal, dass ein Land mit einem AAA-Kreditrating den Klimawandel als ‹systemisches Risiko› anerkennt, wenn es über Risiken für Staatsanleihen spricht.» Insgesamt liege aber noch ein weiter Weg vor Australien, betont die Jurastudentin: «Die Regierung muss nun wirksamen Maßnahmen gegen den Klimawandel Priorität einräumen, um diese Risiken zu mindern», so O’Donnell weiter. Und auch aus Sicht von Clare Schuster, Anwältin bei der Kanzlei «Equity Generation Lawyers», sei die Einigung «ein wichtiger Schritt nach vorn bei der Anerkennung der Verbindung zwischen dem Klimawandel und dem Finanzsystem». [Redaktion Energiewende-Magazin]
«O’Donnell v. Commonwealth and Ors»
Die Melbourner Anwaltskanzlei, die Katta O'Donnell vor dem «Federal Court of Australia» vertritt, hat auf ihrer Website Informationen zur Klage sowie wichtige Dokumente und Quellenlinks bereitgestellt (in englischer Sprache).
Hier geht es zur Übersichtsseite «O’Donnell v. Commonwealth and Ors».
-

«Wir brauchen eine Blut-Schweiß-und-Tränen-Rede»
Eine Klimaerwärmung über vier Grad würde die Menschheit existenziell bedrohen. Der Risikoforscher David Spratt fordert daher eine Mobilisierung der gesamten Gesellschaft – wie in einem Krieg.
-

Fridays for Future: «Wir sind viele, wir sind laut!»
Mit den Schülerstreiks drängt weltweit eine neue Generation auf die Straße. Auch Sophia aus Leipzig fordert konsequenten Klimaschutz – und zwar jetzt.