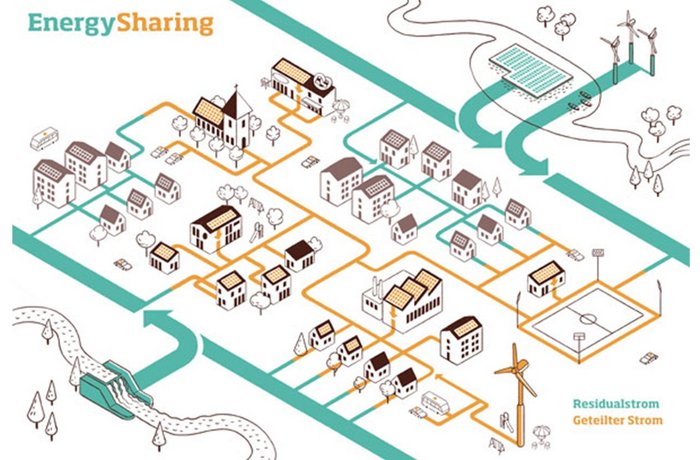Ursprünglich lautete das Ziel der baden-württembergischen Landesregierung, bis 2026 insgesamt 1.000 neue Windräder ans Netz zu bringen – also 250 pro Jahr. Ende 2022 ruderte der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann in der ARD-Sendung «Maischberger» schon deutlich zurück: «Im übernächsten Jahr müssen es sicher wieder 100 werden», formulierte Kretschmann als Zielvorgabe für 2024 und versprach: «Da können sie mich dann beim Wort nehmen.« Letztlich gingen im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg 24 neue Windkraftanlagen in Betrieb mit einer Windkraftleistung von insgesamt 111 Megawatt (MW).
Zwar ist die Zahl der geplanten und auch die der genehmigten Anlagen deutlich gestiegen. Dennoch ist die Enttäuschung in dem grün geführten Bundesland groß. Politiker:innen sehen die Ursachen für den schleppenden Ausbau außerhalb ihrer Verantwortung. So führt beispielsweise Baden-Württembergs Ministerin für Umwelt, Klima und Energie, Thekla Walker, das anhaltende Schneckentempo insbesondere auf den Fachkräfte- und Materialmangel in der Branche zurück: «Leichter zu realisierende Projekte werden daher vorgezogen. Neubauten entstehen aktuell eher in norddeutschen Ebenen als auf schwerer zugänglichen Schwarzwaldhängen», sagte die Grünen-Politikerin der «Schwäbischen Zeitung».
Die EWS Elektrizitätswerke Schönau eG wollten es genauer wissen und beauftragten das Öko-Institut damit, die Gründe für die Verzögerungen herauszufinden. Die Ergebnisse der in den vergangenen Monaten erstellten und nun vorgestellten Studie sind vielschichtig und lassen sich so zusammenfassen: Unsicherheit über die Nutzbarkeit von guten Standorten, stockende Genehmigungsverfahren und höhere Kosten als in anderen Bundesländern verlangsamen den Ausbau der Windenergie in Baden-Württemberg. Die Autorinnen und Autoren der Studie «Beschleunigung des Windenergieausbaus in Baden-Württemberg» zeigen gleichzeitig mit konkreten Handlungsempfehlungen auf, wie Politik und Behörden die vorhandenen Blockaden auflösen könnten.
Hindernisse in mehreren Projektphasen hemmen den Ausbau

Die Untersuchung basiert auf einer umfassenden Datenauswertung sowie auf Interviews mit insgesamt neun Projektierer:innen für Windenergie in Baden-Württemberg. Eine Reihe von Ursachen führte in der Summe bislang dazu, dass der Ausbau der Windenergie in Baden-Württemberg trotz ambitionierter Zielsetzung der Landesregierung nur sehr schleppend verläuft. «Die Hindernisse finden sich insbesondere in den Projektphasen der Flächensicherung, der Genehmigung und des Netzanschlusses», fasst Moritz Vogel, der mit einem siebenköpfigen Autor:innen-Team des Öko-Instituts Freiburg die Studie erstellt hat, die Ergebnisse zusammen.
Download der Studie (PDF):
Beschleunigung des Windenergieausbaus in Baden-Württemberg
Ein Großteil der Befragten sieht eines der größten Fragezeichen bei der ausreichenden Verfügbarkeit von geeigneten Flächen. Bereits jetzt sei absehbar, dass nicht alle der auszuweisenden Flächen nutzbar sind, heißt es in der Studie. Mit der Ausweisung von Windvorrangflächen ist längst nicht entschieden, dass auf den Flächen auch Windenergieanlagen errichtet werden können. Manche Grundstückseigentümer:innen verpachten ihre Flächen nicht; andere Standorte sind ökonomisch nicht geeignet. Auch beim Genehmigungsverfahren sehen interviewte Projektierer:innen Verbesserungsbedarf. So heißt es beispielsweise, dass lange Verfahrensdauern hauptsächlich dann festgestellt werden, wenn die genehmigende Behörde bisher nur wenig Erfahrung mit der Genehmigung von Windenergieanlagen hat. Dann würden häufig auch Nachforderungen zu unterschiedlichen Fachbelangen gestellt und Entscheidungen nur zögerlich getroffen.
Weitere bremsende Faktoren sehen die Interviewten in der teils schlechten Netzinfrastruktur: «Als schwierig gestaltet sich häufig auch der Netzanschluss für die geplanten Windenergieanlagen», fasst die Studie diesen Aspekt zusammen. Netzanschlusspunkte seien oft weit von potenziellen Standorten entfernt, und die Netzkapazität reiche in vielen Fällen nicht für einen zügigen Anschluss aus. Und auch der vierte in der Studie herausgestellte Aspekt liegt im Verantwortungsbereich des Landes selbst: Als problematisch wurde das Ausschreibungsverfahren für Pachtflächen im Staatswald bezeichnet.
Fast alle der befragten Personen gaben an, nicht mehr an den Ausschreibungen teilzunehmen. Der Grund hierfür sei, dass die Pachthöhe zu stark gewichtet wird. Dadurch setzen sich in erster Linie Angebote mit der höchsten Pacht durch, bei denen es fraglich sei, ob die Projekte bei dieser Pachthöhe tatsächlich umgesetzt werden können.

Die Blockaden in diesen vier Bereichen seien hauptverantwortlich dafür, dass das Land seinen Ausbauzielen deutlich hinterherhinke. Im Vergleich zum jährlichen Nettozubau in Baden-Württemberg in Höhe von durchschnittlich 80 Megawatt in den letzten 20 Jahren sei laut Studie eine Steigerung auf jährlich 400 bis 650 Megawatt erforderlich, um den im Netzentwicklungsplan für Baden-Württemberg ausgewiesenen Zubaupfad zu erreichen. Dies entspricht einer Verfünffachung des bisherigen Zubaus.
Die Autor:innen machen in ihrer Studie analog zu den vier Problemfeldern auch vier Handlungsfelder für die Beschleunigung des Windausbaus aus: Mit einer wiederkehrenden Evaluation und Anpassung der Regionalpläne sollte erstens aufgezeigt werden, ob die ausgewiesenen Flächen durch Windenergieprojekte überhaupt nutzbar sind. Zweitens könnte die Umsetzung regionaler und bürgerschaftlicher Projekte vereinfacht werden, indem das Auktionsverfahren für Flächen im Staatswald Baden-Württembergs modifiziert wird. Das Genehmigungsverfahren selbst könnte drittens insbesondere verbessert werden, indem die zuständigen Behörden miteinander und mit den Projektierer:innen besser zusammenarbeiten, wozu unter anderem mehr und besser geschultes Personal beitragen könnte.
Im vierten Handlungsfeld empfiehlt das Öko-Institut schließlich Verbesserungen beim Netzausbau, um den in den Windparks erzeugten Ökostrom mit weniger Aufwand in die Netze einzuspeisen. Ebenfalls kommt die Studie zu dem Ergebnis, dass Windprojekte in Baden-Württemberg zu höheren Kosten als jene in norddeutschen Bundesländern umgesetzt werden. Mit Blick auf steigendes Interesse an den EEG-Auktionen sollte eine Überarbeitung davon überprüft werden, z. B. durch eine Anpassung des Referenzertragsmodells.
Bürgerbeteiligung und verlässliche Finanzierungsbedingungen wichtig

Geschäftsführer der EWS Energie GmbH
«In Baden-Württemberg gibt es viele gute Windstandorte, die Investitionskosten sind in Baden-Württemberg aufgrund einer vielfach anspruchsvollen Topografie und damit einhergehend aufwändigen Logistik jedoch höher als in vielen anderen Bundesländern», sagt dazu Tobias Tusch, Geschäftsführer der EWS Energie GmbH. Um Windparks in Baden-Württemberg wirtschaftlich betreiben zu können, müssten daher die laufenden Kosten während der Betriebsdauer im Rahmen bleiben: «Bei den laufenden Kosten spielen die zu zahlenden Pachten eine entscheidende Rolle und ausufernde Pachtforderungen erhöhen die Umsetzungsrisiken von Projekten. Insbesondere öffentliche Grundstückseigentümer:innen haben hier aus unserer Sicht auch eine Verantwortung – insbesondere gegenüber Bürgerenergie, denn Bürgerbeteiligung erhöht die Akzeptanz für die Windkraft», so Tusch weiter.

Energiepolitischer Sprecher der EWS
Dass die Ausbauziele auf Länderebene nur dann erreicht werden können, wenn die Voraussetzungen dafür auch auf Bundesebene geschaffen werden, betont Peter Ugolini-Schmidt, Energiepolitischer Sprecher der EWS: «Ein verlässlicher Finanzierungsrahmen für Erneuerbare Energien ist eine Grundvoraussetzung für die Beibehaltung eines hohen Ausbautempos. Die neue Bundesregierung sollte die aufgrund europäischer Vorgaben notwendige Weiterentwicklung des Finanzierungsrahmens für die Erneuerbaren intensiv mit der Branche diskutieren, bevor falsch abgebogen wird», so Ugolini-Schmidt weiter. Nur so könnten Rückschritte bei der Energiewende wie im Jahr 2017 verhindert werden, als im Rahmen der Einführung des Ausschreibungssystems der Windenergieausbau in Süddeutschland zeitweise vollständig zum Erliegen kam. Darüber hinaus sei es wichtig, dass es auch einen starken Impuls für den rein marktlich getriebenen EE-Ausbau über Power-Purchase-Agreements (PPA) gebe. Insbesondere für kleine und mittelständische Akteur:innen seien PPA aufgrund von Ausfallrisiken und höherer energiewirtschaftlicher Anforderungen nach wie vor schwer zu händeln: «Hier könnte ein bundesweites Bürgschaftsprogramm für PPA Abhilfe schaffen», schlussfolgert Ugolini-Schmidt.